Der Erfindungswert einer innerbetrieblich eingesetzten Diensterfindung kann auf Basis der Investitionskosten ermittelt werden. Besonders war in diesem Fall zudem, dass die Softwareerfindung nur in den USA patentiert und in Europa möglicherweise nicht patentfähig war.
 Die Erfindung, um die es in diesem interessanten Fall vor die Schiedsstelle des DPMA ging, wurde als eine Softwareerfindung für ein Arbeitgeber-internes soziales Netzwerk verwendet, um letztlich einen als Spam empfundenen Informationsüberfluss in diesem Netzwerk zu vermeiden.
Die Erfindung, um die es in diesem interessanten Fall vor die Schiedsstelle des DPMA ging, wurde als eine Softwareerfindung für ein Arbeitgeber-internes soziales Netzwerk verwendet, um letztlich einen als Spam empfundenen Informationsüberfluss in diesem Netzwerk zu vermeiden.
Die erfindungsgemäße Lösung führte zu einer Selektion des angesprochenen Nutzerkreises im Arbeitgeber-Netzwerk abhängig von dem von der Anfrage betroffenen Geschäftswert, der vom Anfragenden in seiner Anfrage voreingestellt wurde.
Softwareerfindung nur in den USA patentiert
Patentschutz für die Erfindung wurde nur in den USA angestrebt und dort auch erreicht. Dahingegen fehlte es in Deutschland und Europa an einer Schutzrechtsanmeldung. Mehr noch, hatte die Schiedsstelle doch –zurecht – erhebliche Zweifel, ob diese Softwareerfindung in Deutschland überhaupt patentfähig gewesen wäre.
In diesem Kontext ist für Sie möglicherweise ein kleiner Überblick zu Patententscheidungen über Softwareerfindungen interessant:
- Software patentierbar in DE? Datenübertragung und Verarbeitung im Prozessor
- Computerimplementierte Erfindungen: Case Law des EPA
Arbeitnehmererfindergesetz nur für patentfähige Diensterfindungen
Dies ist nicht unbedeutend, denn das Arbeitnehmererfindergesetz und die Verpflichtung eines Arbeitgebers, Diensterfindungen regelkonform zu vergüten, gilt nur für patentfähige Erfindungen und – mit Einschränkung- für technische Verbesserungen. Entscheidend ist nicht das erteilte Patent – lesen Sie gerne auch unsere Beiträge beispielsweise zu Vorratspatent, Sperrpatent, Risikoabschlag und zurückgezogenem Patentanmeldung – sondern die Patentfähigkeit der Erfindung und die erfolgte Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber.
Im vorliegenden Fall mit der in den USA erfolgten Patenterteilung unterstellte die Schiedsstelle fiktiv eine Patentanmeldung auf die Erfindung in Deutschland und konnte so formal den Erfindungswert herleiten. Einnahmen durch die Erfindung lagen nicht vor, die Softwareerfindung wurde ausschließlich innerbetrieblich genutzt. Die Arbeitgeberin hatte die als Diensterfindung gemeldete technische Lehre im Betrieb benutzt, aber nach wenigen Jahren eingestellt und durch ein anderes System ersetzt, so dass die getätigten Investitionen keine dauerhaften Vorteile nach sich gezogen haben.
Hohe Entwicklungskosten
Doch waren die auf die Erfindung entfallenden Entwicklungskosten bekannt, sie lagen im sechsstelligen Bereich. Die Schiedsstelle empfahl daher im Gesamtkontext, die Investitionskosten als Grundlage für die Ermittlung des Erfindungswerts zu wählen. Denn es handelt sich einerseits um eine recht hohe Investitionssumme und zudem erschienen der Schiedsstelle die real auf die Erfindung zurückgehenden Vorteile nicht übermäßig groß wie es beispielsweise bei Steigerung des Börsenwerts eines Unternehmens wäre.
Investitionskosten als Basis zur Ermittlung des Erfindungswerts
Daher können also die Investitionskosten einer innerbetrieblich eingesetzten Softwareerfindung – Entwicklungskosten und Kosten durch die Implementierung der Software – herangezogen werden für die Ermittlung des Erfindungswerts, entschied die Schiedsstelle. Diese stellen jedoch noch nicht den Erfindungswert dar, denn auf einen erfassbaren betrieblichen Nutzen muss ein Umrechnungsfaktor angewandt werden – dies berücksichtigt das Risiko des Unternehmers und einen angemessenen Gewinnanteil für den Arbeitgeber. Dieser Umrechnungsfaktor liege abhängig von der Stärke der Schutzrechtsposition in einer Bandbreite von 1/8 – 1/3, in der Regel bei 1/5 (= 20 %), führte die Schiedsstelle aus. Das entspreche dann auch marktüblichen Lizenzverträgen, die umsatzbezogen geschlossen werden.
Umrechnungsfaktor auf Erfindungswert
Die Arbeitgeberin hatte einen Umrechnungsfaktor von lediglich 12,5 % gewählt. Die Schiedsstelle hielt jedoch einen doppelt so hohen Faktor für angemessen, einen sogar über dem Regelumrechnungsfaktor liegender Umrechnungsfaktor von 25 % für den Erfindungswert der Softwareerfindung. Andererseits sollte damit die streitgegenständliche Diensterfindung auch abschließend vergütet sein, beschloss die Schiedsstelle.
Einmal mehr wurde die Schiedsstelle ihrem Auftrag gerecht, für einen annehmbaren Kompromiss und Ausgleich zwischen den Parteien in beider Interesse zu sorgen. Sie empfahl dem Arbeitgeber, die Problematik der lediglich in den USA erfolgten Schutzfähigkeit erheblich weniger zu gewichten und sich auf den erwiesenen Nutzen durch die Softwareerfindung zu besinnen.
Benötigen auch Sie Unterstützung im Arbeitnehmererfindungsrecht?
Gern beraten wir Sie und vertreten wir Ihre Interessen sowohl vor der Schiedsstelle als auch in einem möglicherweise notwendig werdenden Gerichtsverfahren.
Nutzen Sie gerne unser unverbindliches Beratungsangebot.

Quellen:
Entscheidung der Schiedsstelle Arb.Erf. 38/18
Bild:
geralt | pixabay.com | CCO License




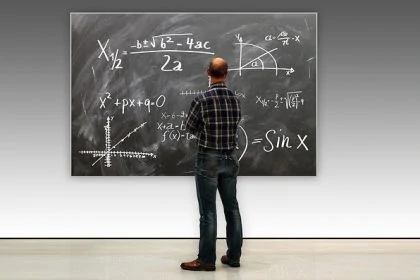


Schreiben Sie einen Kommentar