In einem Streitfall um eine Erfindervergütung nachläufig zu Geschäftsjahren vor der Schiedsstelle gab es eine Entscheidung, die relevant ist für Arbeitgeber wie für Diensterfinder: auf Vergütungsvereinbarungen, die nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses getroffen wurden, soll § 23 ArbEG keine Anwendung finden.
 Die Angemessenheit von Erfindervergütung ist in der Praxis ein häufiger Rechtsstreit. Besonders unübersichtlich wird die Sachlage, je komplexer das Produkt ist, in dem die Erfindung verbaut ist. Dabei gilt grundsätzlich: Wenn möglich, wird für eine angemessene Erfindervergütung aus der Wirkung der erfindungsgemäßen Lehre auf das Gesamtprodukt der Anteil am realen Produktumsatz sachgerecht abgeleitet.
Die Angemessenheit von Erfindervergütung ist in der Praxis ein häufiger Rechtsstreit. Besonders unübersichtlich wird die Sachlage, je komplexer das Produkt ist, in dem die Erfindung verbaut ist. Dabei gilt grundsätzlich: Wenn möglich, wird für eine angemessene Erfindervergütung aus der Wirkung der erfindungsgemäßen Lehre auf das Gesamtprodukt der Anteil am realen Produktumsatz sachgerecht abgeleitet.
Wenn das aber nicht möglich ist, dann gilt als sachgerecht, in der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags auf die Herstellungskosten oder die Einkaufspreise bestimmter Bauteile oder Bauteilgruppen abzustellen. Das ist oftmals der Fall bei sehr komplexen Produkten wie beispielsweise Kraftfahrzeugen oder Flugzeugen, kann aber auch grundsätzlich bei Erfindungen mit Bauteilen vorkommen. Denn wie ist ein Wettbewerbsvorteil durch ein erfindungsgemäßes Bauteil überhaupt zu bemessen? Nur die Produkte, in denen ein solches Bauteil verbaut ist, generieren die realen Produktumsätze.
Fallkonstellation: betriebsinterne Diensterfinder, Vergütung nach erzieltem Umsatz
Die Schiedsstelle entschied in so einem Fall im Jahr 2020 (Arb.Erf. 57/18) einer betriebsinternen Diensterfindung, in dem die wesentlichen Streitpunkte waren, ob die Vergütungsvereinbarung angemessen war in Bezug auf das darin angewendete „zukunftsbezogene“ System. Und da der inzwischen aus dem Unternehmen ausgeschiedene Erfinder diese Vereinbarung nicht als angemessen erachtete, und zwar als in hohem Maße nicht angemessen, machte er auch den Vorwurf der Unbilligkeit geltend gemäß § 23 ArbEG.
Das angewendete „zukunftsbezogene“ System für die Vergütungsvereinbarung zwischen den Parteien sah wie folgt aus: Bezugsgröße und Lizenzsatz wurden in ein zukunftsbezogenes systematisches Verhältnis gesetzt. Zum Streit über die Vereinbarung kam es, als die Arbeitgeberin für die nachfolgenden Jahre im Jahr 2018 gefertigte Vergütungsblätter nicht mehr wie bisher prozentual festgelegte Anteile an mit verkauften Maschinen erzielten Umsätzen als Bezugsgröße zu Grunde gelegt hatte, sondern nur noch die Herstellungskosten für bestimmte Baugruppen der Maschinen, die sie pauschal mit einem Faktor von 1,3 beaufschlagt hatte.
Diese Sachlage warf im Grunde mehrere Fragen auf, die von der Schiedsstelle in ihre Überlegungen einbezogen wurde: die relevante Bezugsgröße, Gewinnaufschläge und die Aussagekraft von Herstellungskosten in Bezug auf eine Diensterfindung. Denn nur wenn über das streitgegenständliche Schutzrecht oder zumindest über den betroffenen Technologiebereich bereits ein oder mehrere Lizenzverträge abgeschlossen wurden, ist eine Abschätzung des Erfindungswerts über die fiktive Nachbildung dessen für die betriebsinterne Erfindung relativ einfach und auch relativ objektiv möglich.
Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße
Das aber war vorliegend nicht der Fall. Es muss daher in erster Näherung die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße eingeschätzt werden. Bei dieser Wertung werde an das angeknüpft, was von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird, erklärte die Schiedsstelle mit Bezug auf die höchstrichterliche Entscheidung des BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.
Es sei also zu überlegen, wo in einem Produkt sich die Erfindung technisch niederschlägt und die entsprechenden Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren. Die Schiedsstelle verwies jedoch darauf, dass es zu kurz greife, wenn in einem solchen Fall zur Ermittlung der Bezugsgröße lediglich auf die Herstellungskosten oder gegebenenfalls den Einkaufspreis eines bestimmten Bauteils bzw. einer Baugruppe abgestellt würde. Vielmehr sollte die Arbeitgeberseite stets die Kontrollfrage stellen, erläuterte die Schiedsstelle, zu welchen Vertragsbedingungen man theoretisch bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren, bezogen auf eine fiktive Ein-Lizenzierung der Erfindung.
Zwar könne man sich mit sehr komplexen Produkten damit behelfen, anstatt auf Nettoverkaufspreise ab Werk des Endprodukts auf bekannte und validierbare interne Bauteil- oder Baugruppenpreise abzustellen und diese dann produktbezogen auf Nettoverkaufspreise hochzurechnen, ergänzte die Schiedsstelle. Dann aber sei es erforderlich, den Gewinnaufschlag zu kennen, mit dem ausgehend von Einkaufspreisen oder Herstellungskosten einzelner Bauteile oder Baugruppen der Nettoverkaufspreis des Endprodukts kalkuliert wird.
Gewinnaufschläge und Stellung des Unternehmens
Gewinnaufschläge jedoch sind weder rein schematisch und noch absolut zu sehen, es kam also auch im vorliegenden Fall auf die Konstellation des Einzelfalls an. Und darin hatte die Arbeitgeberin die Umstellung von einer anteiligen Produktumsatzbetrachtung auf einen herstellungskostenbezogenen Ansatz damit begründet, dass die anteilige Umsatzbetrachtung eine rechnerisch nicht nachprüfbare Schätzung sei und dass die aus dem internen EDV-System entnommenen Herstellkosten einzelner Bauteile beaufschlagt mit einem Deckungsbeitrag / Gewinnaufschlag von 30 % stets die von fiktiven Lizenzvertragsparteien zu wählende Herangehensweise sachgerecht wiedergeben würde. Die Arbeitgeberin betonte auch ihre Stellung als weltweites Schweizer Unternehmen mit Qualitätsprodukten, und diese Stellung sei ausschlaggebend für die Produktumsätze.
Doch diesem Argument folgte die Schiedsstelle nicht vollumfänglich. Die Bekanntheit und Stellung des Unternehmens sei relevant in der Frage der Abstaffelung von Lizenzsätzen, erklärte die Schiedsstelle und ergänzte: Produkte wie die hier streitgegenständlichen würden auch aufgrund eines guten Rufs verkauft, aber nicht alleine deswegen.
Entscheidung der Schiedsstelle
Die Schiedsstelle war daher im vorliegenden Fall der Auffassung, dass die Beteiligten im Jahr 2015 die für die Berechnung des Erfindungswerts maßgeblichen Faktoren verbindlich auch für die Zukunft vereinbart hatten und daran gemäß dem Grundsatz, dass man sich an Verträge zu halten hat (Vertragstreue – „pacta sunt servanda“), gebunden seien.
Hat der Arbeitgeber in der Vergütungsvereinbarung die den Erfindungswert bestimmenden Faktoren Bezugsgröße und Lizenzsatz in ein über eine einmalige Vergütung weit hinausgehendes und zukunftsbezogenes systematisches Verhältnis gesetzt und aufgrund dessen jährliche Vergütungsbeträge ermittelt und ausbezahlt, die der Erfinder jeweils widerspruchslos entgegengenommen hat, sind beide Parteien an die angewendeten Berechnungsfaktoren gebunden, erklärte die Schiedsstelle. Darin hatte im vorliegenden Fall die Arbeitgeberin die Lizenzsätze in Abhängigkeit vom Erreichen von auf die Gesamtlaufzeit bezogenen Umsatzschwellen abgestaffelt, und so wurde die Vergütung einvernehmlich gezahlt. Hierdurch sei zwischen den Parteien konkludent eine Vergütungsvereinbarung mit den in den Vergütungsblättern angewendeten Berechnungsfaktoren zustande gekommen, stellte die Schiedsstelle daher fest. Denn da § 12 Abs. 1 ArbEG für eine Vergütungsvereinbarung keine bestimmte Form vorschreibt, erklärte die Schiedsstelle, entstehe eine verbindliche Vergütungsvereinbarung auch durch konkludentes Handeln.
Unbilligkeit – geltend zu machen in nachläufigen Geschäftsjahren
Sehr interessant ist auch die Entscheidung der Schiedsstelle zu dem ebenfalls vom Erfinder erhobenen Vorwurf der Unbilligkeit. Der Erfinder war Ende 2011 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Er hätte daher bis zum 30. Juni 2012 Unbilligkeit geltend machen müssen, denn die Frist zur Geltendmachung eines Unbilligkeitseinwands des § 23 ArbEG beträgt 6 Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Doch im vorliegenden Fall basierte die vereinbarte Bezugsgröße ja auf der Höhe des erzielten jährlichen Umsatzes; entsprechend wurde die Erfindervergütung nachläufig zu Geschäftsjahren abgerechnet. In der Praxis führte das zu der Konstellation, dass die Vergütungsvereinbarungen, um die es im vorliegenden Fall geht, überhaupt noch nicht abgeschlossen waren, als die Frist für die Geltendmachung der Unbilligkeit abgelaufen war, denn diese Vergütungsvereinbarungen stammten aus dem Jahr 2015.
Die Schiedsstelle stellte daher in Frage, ob die Sechsmonatsfrist des § 23 Abs. 2 ArbEG auch für Fälle gilt, in denen der Arbeitnehmer Vergütungsvereinbarungen mit dem Arbeitgeber erst nach seinem Ausscheiden getroffen hat, insbesondere später als ein halbes Jahr nach seinem Ausscheiden. Und diese Frage wurde auch direkt von der Schiedsstelle beantwortet:
Da der Gesetzgeber – die Bundesregierung im Jahr 1955 – bei der Schaffung des § 23 ArbEG nachdrücklich Benachteiligungen des Arbeitnehmers ausschließen wollte, die sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber ergeben können, entschied die Schiedsstelle im vorliegenden Fall, dass § 23 ArbEG auf Vergütungsvereinbarungen, die nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses getroffen wurden, keine Anwendung finden soll.
Gerne beraten und vertreten wir Sie im Fall einer Diensterfindung
Unsere Kanzlei für Patent- und Markenrecht verfügt über eine weitreichende Expertise im Bereich des Patentrechts und Erfinderrechts. Sprechen Sie uns gerne an.
Quellen:
Bild:
Fachdozent | pixabay.com | CCO License



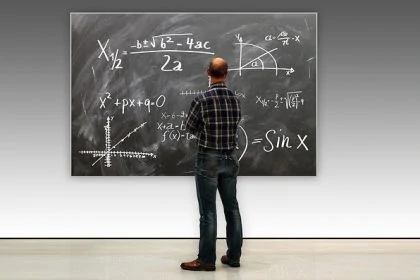



Schreiben Sie einen Kommentar