Wird der Patentschutz einer Diensterfindung vom Arbeitgeber nicht oder nicht mehr in Anspruch genommen, gibt es einen Freigabeanspruch auf eine Diensterfindung. Hat der Arbeitnehmererfinder automatisch Anspruch darauf?
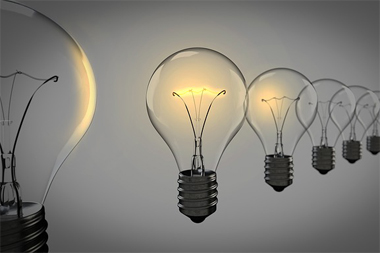 Eine Erfindung, die während der Arbeitszeit in einer Firma entsteht, gehört zunächst dem Arbeitgeber. Dies gilt für Arbeiternehmer im privaten und im öffentlichen Dienst. Im normalen Ablauf informiert ein Diensterfinder seinen Arbeitgeber über seine Erfindung. Gemäß § 13 Abs. 2 Arbeitnehmererfindungsgesetzt (ArbEG) ist dann ein Arbeitgeber verpflichtet, die Erfindung zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Der Arbeitgeber muss darin den Arbeitnehmer als Erfinder nennen. Wörtlich heißt es im ArbEG, die Anmeldung habe „unverzüglich“ zu geschehen. Dies dient vor allem der Prioritätssicherung für die Erfindung.
Eine Erfindung, die während der Arbeitszeit in einer Firma entsteht, gehört zunächst dem Arbeitgeber. Dies gilt für Arbeiternehmer im privaten und im öffentlichen Dienst. Im normalen Ablauf informiert ein Diensterfinder seinen Arbeitgeber über seine Erfindung. Gemäß § 13 Abs. 2 Arbeitnehmererfindungsgesetzt (ArbEG) ist dann ein Arbeitgeber verpflichtet, die Erfindung zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Der Arbeitgeber muss darin den Arbeitnehmer als Erfinder nennen. Wörtlich heißt es im ArbEG, die Anmeldung habe „unverzüglich“ zu geschehen. Dies dient vor allem der Prioritätssicherung für die Erfindung.
Erkennt der Arbeitgeber aber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung überhaupt nicht an, so kann er von der Anmeldung eines Schutzrechts absehen. In dem Fall muss er zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle des DPMA anrufen. (§ 17 ArbEG, § 29).
Patentschutz vom Arbeitgeber nicht in Anspruch genommen
Was aber geschieht, wenn der Arbeitgeber den Patentschutz einer Diensterfindung ohne Anrufung der Schiedsstelle gar nicht erst in Anspruch nimmt? Gibt es einen automatischen Freigabeanspruch des Arbeitnehmers?
Nach der bis zum 30.09.2009 geltenden Gesetzesfassung musste der Arbeitgeber schriftlich und innerhalb von 4 Monaten nach der Erfindermeldung gegenüber seinem Arbeitnehmer die Freigabe erklären. Tat er dies nicht oder zu spät, so wurde die Erfindung frei, das bedeutete dies, dass die Schutzrechte automatisch und allein dem Arbeitnehmer als Erfinder zustanden.
In der jetzt geltenden Gesetzesfassung – die sogenannte Inanspruchnahmefiktion – ist dies genau umgekehrt festgelegt. Der Arbeitgeber muss jetzt ausdrücklich die Freigabe erklären. Tut er es nicht, gilt die Erfindung als in Anspruch genommen, auch ohne eine Patentanmeldung durch den Arbeitgeber.
Die sogenannte Inanspruchnahmefiktion gilt erst für Erfindungen, die ab dem 01.10.2009 gemacht worden sind und löst somit die vorherige Freigabefiktion nach Ablauf von vier Monaten nach Anzeige der Diensterfindung ab.
Vor dem 1.10.2009 sind Diensterfindungen freigeworden, wenn der Arbeitgeber die Inanspruchnahme nicht innerhalb von vier Monaten schriftlich erklärt hat. Heute ist es genau umgekehrt: Von der Inanspruchnahme ist dann auszugehen, wenn der Arbeitgeber die Freigabe nicht vor Ablauf von vier Monaten erklärt.
Für freie Erfindungen (also solche, die nicht zweckgebunden für den Betrieb gemacht wurden (§ 4 Abs. 2 ArbnErfG)) verbleibt es bei der alten Regelung: Die Inanspruchnahme muss innerhalb von drei Monaten erklärt werden. Diese kann jetzt aber auch in Textform erfolgen.
Ein besonderer Fall liegt vor, wenn der Arbeitnehmer seine Diensterfindung korrekt dem Arbeitgeber gemeldet hat und der Arbeitgeber die Erfindung auch patentiert, sie aber dennoch “offiziell” nicht in Anspruch nimmt. Der BGH hatte dazu im vielbeachteten Urteil „Lichtschutzfolie“ klargestellt, dass spätestens mit Einreichung der Erfindung zum Patent und der Nennung des Arbeitnehmers als Erfinder eine Erfindung als ordentlich gemeldet gilt (siehe unter Diensterfindung: Patentanmeldung bei nicht-offizieller Inanspruchnahme).
Patentschutz vom Arbeitgeber nicht mehr in Anspruch genommen
Ebenso häufig geschieht es in den Betrieben aber auch, dass ein bereits gemäß § 6 ArbEG in Anspruch genommenes Schutzrecht auf eine Diensterfindung vom Arbeitgeber aufgegeben wird. Durch die Inanspruchnahme sind nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung in das Eigentum des Arbeitgebers übergegangen. Es unterliegt ausschließlich seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, für welche Form der Verwertung der Diensterfindung sich der Arbeitgeber sich entschließt.
Unternehmerische Entscheidungsfreiheit über Nutzung eines Schutzrechtes
Die Gestaltung des Betriebs und die Frage, ob und in welcher Weise sich ein Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist Bestandteil der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit, wie sie sich aus Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableiten lässt (BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – AZ.: 2 AZR 673/11).
Daher unterliegt es der freien Entscheidung des Arbeitgebers, ein Schutzrecht nicht oder nicht mehr betrieblich zu nutzen. Er kann auch entscheiden, es zum Beispiel als Vorratspatent in seinem Portfolio zu behalten und es auf diese Art weiter zu verwerten (siehe unter Vorratspatent: Wie berechnet man die Arbeitnehmererfindung?). Folglich obliegt es ausschließlich des Arbeitgeber, ob sie ihre mit der Inanspruchnahme erworbenen vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung freigeben möchte oder nicht. Unter dem Aufgeben eines Schutzrechts wird eine Nichtverlängerung des Schutzrechts – praktisch durch keine weitere Zahlung der Jahresgebühren- oder ein Nichteinlegen eines möglichen Rechtsmittels im Erteilungsverfahren verstanden.
Voraussetzung für einen Anspruch des Erfinders auf Übertragung eines Schutzrechts ist, dass der Arbeitgeber aus freien Stücken das Schutzrecht nicht aufrechterhalten will. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer seine Aufgabeabsicht mitteilen und damit dem Arbeitnehmer die Übernahme des Schutzrechts anbieten. Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Schutzrecht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Schutzrechts verlangt (§ 16 ArbEG). Hintergrund dazu ist, dass dem Arbeitnehmererfinder eine Vergütung aus der betrieblichen Nutzung seines Patents zusteht. Das uneingeschränkte Recht zur Aufgabe von Schutzrechten hat ein Arbeitgeber nur, wenn sämtliche Vergütungsansprüche bereits voll erfüllt sind – für die Vergangenheit und die Zukunft.
Fazit
Äußert sich der Arbeitgeber nicht, so hat es nach neuem Recht für die Inanspruchnahme keine Auswirkung. Da ein Patent maximal 20 Jahre Schutz genießt, kann die Aufgabe des Anspruchs durch den Arbeitgeber rechtlich interessant sein vor allem für alle Meldungen, die vor dem 30.09.2009 gemacht wurden. Arbeitnehmer sollten ihre Unterlagen zu prüfen, ob der Arbeitgeber die Inanspruchnahme und Anspruchsaufgabe richtig erklärt hat. Hat er dies nicht, stehen dem Arbeitnehmer nicht nur die Rechte an der Erfindung zu, sondern möglicherweise auch Ansprüche auf Schadenersatz wegen widerrechtlicher Entnahme. Arbeitgeber sollten beachten, dass sie nicht nur Pflichten bei der Inanspruchnahme eines Patents haben, sondern auch bei dessen Freigabe.
Haben Sie eine Diensterfindung gemacht? Oder sind Sie als Arbeitgeber über den Freigabeanspruch der Schutzrechte besorgt?
Die Patentanwaltskanzlei Dr. Meyer-Dulheuer verfügt über eine weitreichende Expertise im Bereich des Patentrechts und Erfinderrechts.
Gern vertreten wir Ihre Interessen sowohl vor der Schiedsstelle als auch in einem möglicherweise notwendig werdenden Gerichtsverfahren. Nutzen Sie unser unverbindliches Rückrufangebot.
Quellen:
BGH Urteil v. 14.02.2017, AZ. X ZR 6415 – „Lichtschutzfolie“
Bild:





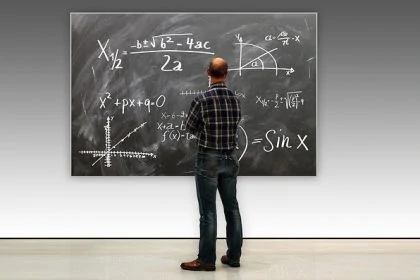


Guten Tag,
möglicherweise habe ich es überlesen, aber das ist so doch unvollständig:
„Äußert sich der Arbeitgeber nicht, so hat es nach neuem Recht für die Inanspruchnahme keine Auswirkung.“
Es ist doch der wichtige Fall zu betrachten, dass sich der Arbeitgeber nicht äußert und auch kein Schutzrecht anmeldet. Versäumt der Arbeitgeber es in diesem Fall, die Erfindung aktiv dem Arbeitnehmer freizugeben, so macht er sich unter Umständen dem Erfinder gegenüber schadensersatzpflichtig.
Guten Tag, Herr Maiwald,
gleich vorab: unser Beitrag ist vollständig, Sie haben Entscheidendes überlesen.
Dennoch freuen wir uns über Ihr Interesse an unserem Artikel, dies gibt uns Gelegenheit, auch noch den Themenkomplex Schadenersatz und Verjährung in diesem Kontext zu erläutern.
Sie haben diesen Satz in unserem Beitrag überlesen, der genau den Fall beschreibt, dass ein Arbeitgeber sich nicht äußert und auch kein Schutzrecht anmeldet: „Der Arbeitgeber muss jetzt ausdrücklich die Freigabe erklären. Tut er es nicht, gilt die Erfindung als in Anspruch genommen, auch ohne eine Patentanmeldung durch den Arbeitgeber.“
Gerne ergänzen wir in aller Deutlichkeit: ein Arbeitgeber ist verpflichtet, auf eine Erfindermeldung zu reagieren – mit einer Patentanmeldung oder der Freigabe der Erfindung oder auch mit einer Antwort, dass er nicht der Meinung ist, dies sei eine patentfähige Arbeitnehmererfindung. Entscheidend ist hier, dass die Erfindermeldung eine ordnungsgemäße Erfindermeldung ist. Reagiert ein Arbeitgeber darauf nicht, besteht ein Anspruch auf Vergütung und auch gegebenenfalls auf Schadensersatz. Zu beachten sind dazu die Regeln der Verjährung für Vergütung und Schadensersatz bei Diensterfindungen. Kurz gesagt gilt hierbei: Ansprüche auf Vergütung verjähren nach 3 Jahren, Ansprüche auf Schadensersatz dagegen erst nach 10 Jahren. Es ist allerdings nicht möglich, einen Schadensersatz geltend zu machen, ohne einen Vergütungsanspruch innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist gestellt zu haben.
Auch wichtig: Verhandlungen vor der Schiedsstelle um Ansprüche aus einer Diensterfindung gelten als Hemmnis der Verjährung, eine solche Verhandlung verlängert also den Zeitraum, in dem Ansprüche geltend gemacht werden können.
Mit freundlichem Gruß
Das Team der Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB