Um von einem Second-Source-Lizenzvertrag auf einen marktüblichen Lizenzvertrag rückzuschließen, müssen vereinbarte Lizenzgebühren aus Second-Source-Lizenzverträgen im Regelfall deutlich höher ausfallen als dies in normalen marktüblichen Lizenzverträgen der Fall wäre. Dies ist auch bedeutsam für Arbeitnehmererfinder und den Erfindungswert der Diensterfindung.
Second-Source Lizenzvertrag beeinflusst Erfindervergütung
 Ein sogenannter Second-Source-Lizenzvertrag ist weit verbreitet in der Zulieferbranche. Ein solcher Second-Source-Lizenzvertrag ermöglicht es Herstellern, erfindungsgemäße Bauteile auch von anderen Zulieferunternehmen zu beziehen. Für die Berechnung der Vergütung einer Arbeitnehmererfindung sind aus diesen Vereinbarungen wiederum die Erfindungswerte marktüblicher Lizenzverträge abzuleiten. Denn eine patentfähige Diensterfindung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (§§ 9, 33 PatG). Benutzt er eine solche Diensterfindung, so macht er von diesem Monopolrecht Gebrauch. Ein Arbeitgeber hat daher seinem Angestellten und Arbeitnehmererfinder zu vergüten, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste, ermittelt mit der Lizenzanalogie.
Ein sogenannter Second-Source-Lizenzvertrag ist weit verbreitet in der Zulieferbranche. Ein solcher Second-Source-Lizenzvertrag ermöglicht es Herstellern, erfindungsgemäße Bauteile auch von anderen Zulieferunternehmen zu beziehen. Für die Berechnung der Vergütung einer Arbeitnehmererfindung sind aus diesen Vereinbarungen wiederum die Erfindungswerte marktüblicher Lizenzverträge abzuleiten. Denn eine patentfähige Diensterfindung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (§§ 9, 33 PatG). Benutzt er eine solche Diensterfindung, so macht er von diesem Monopolrecht Gebrauch. Ein Arbeitgeber hat daher seinem Angestellten und Arbeitnehmererfinder zu vergüten, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste, ermittelt mit der Lizenzanalogie.
Wird eine Erfindung zur Herstellung von am Markt vertriebenen Produkten eingesetzt, ist für die Ermittlung des Erfindungswerts zunächst festzulegen, welche Nettoumsätze die Lizenzvertragsparteien einem normalen und marktüblichen Lizenzvertrag zu Grunde gelegt hätten. Dies wurde detailliert beschrieben in einer Entscheidung der Schiedsstelle des DPMA.
Der Sachverhalt
Die Antragsteller sind bzw. waren langjährig bei der Antragsgegnerin beschäftigt und Erfinder verschiedener Diensterfindungen. Die Antragsgegnerin ist ein wichtiges Zulieferunternehmen der Automobilindustrie, das aufgrund seiner Marktposition sehr große Stückzahlen vertreiben kann. Streitgegenstand im vorliegenden Fall vor der Schiedsstelle des DPMA (Arb.Erf. 30/16) bilden zwei Erfindungskomplexe, über die die Arbeitgeberin jeweils einen sogenannten Second-Source-Lizenzvertrag abgeschlossen hatte.
Der für den ersten Erfindungskomplex abgeschlossene Lizenzvertrag sieht für den Fall, dass ihre Umsätze aufgrund von Second-Source-Lieferungen bestimmte Schwellen unterschreiten, eine Stücklizenz von 0,5 € bei einem Produktpreis von 50 € vor. Damit ist ein Komplexlizenzsatz von 1 % des Umsatzes vereinbart. Für den zweiten Erfindungskomplex wurde ein Komplexlizenzsatz von 3 % des Umsatzes vereinbart. Darauf basierend hat die Arbeitgeberin für die Geschäftsjahre 2007 bis 2013 die Vergütung der Diensterfindungen festgesetzt und ausbezahlt. Der Vergütungsfestsetzung für den ersten Erfindungskomplex hat sie zur Ermittlung des Erfindungswerts einen nach Richtlinie Nr. 11 abgestaffelten Komplex-Lizenzsatz von 1,5 % bei einem erfindungsgemäßen Wertanteil am Umsatz von 15 % und einen Anteilsfaktor von 18 % zugrunde gelegt.
Auch für den zweiten Erfindungskomplex, bestehend aus drei Diensterfindungen, wurde für die Geschäftsjahre 2007 bis 2013 die Vergütung festgesetzt und ausbezahlt. Diesem Vergütungsfestsetzung wurde ein abgestaffelter KomplexLizenzsatz von 4,5 % bei einem erfindungsgemäßen Wertanteil am Umsatz von 15 % und einen Anteilsfaktor von 18 % zugrunde gelegt. Die Arbeitgeberin benutzt den zweiten Erfindungskomplex bei der Produktion von Einheiten. Daher teilte sie den Gesamtumsatz entsprechend der Bedeutung der einzelnen Diensterfindungen auf die drei Diensterfindungen auf und wies den Diensterfindungen Umsatzanteile von 5,87 % , 57,08 % und 37,05 % mit einen Risikoabschlag von 50 % auf alle drei Diensterfindungen.
Die Diensterfinder widersprachen der Vergütungsfestsetzung für beide Erfindungskomplexe und wandten sich vor allem gegen die Ermittlung der Erfindungswerte. Der Anteilsfaktor von 18 % wurde von den Beteiligten nicht diskutiert, wurde von der Schiedsstelle aber als entgegenkommend von der Arbeitgeberin bewertet und so auch von der Arbeitgeberin selbst gesehen.
Höhe des Vergütungsanspruchs
Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG – neben Stellung des Arbeitnehmererfinders im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung – nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Dazu zählen die Lizenzierung, der Verkauf und die tatsächliche Benutzung der patentgeschützten Diensterfindung im eigenen Betrieb, wie auch im vorliegenden Fall. Auch hänge die richtige technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße maßgeblich vom Einfluss der monopolgeschützten Technik auf das Produkt ab, stellt die Schiedsstelle klar. Nach der Rechtsprechung des BGH sei an die technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird (BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung). Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem auf dem jeweiligen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen wieder: Produktsparten mit relativ geringen Margen wie beispielsweise der Zulieferbereich der Automobilindustrie weisen einen relativ niedrig liegenden Lizenzsatzrahmen auf, Produktsparten mit relativ hohen Margen wie beispielsweise die Medizintechnik einen deutlich höher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen.
Abstaffelung ist angemessen für hohe Umsätze
Partizipiert ein Erfinder wie im vorliegenden Fall am Markterfolg eines wichtigen Autozulieferers, partizipiert er auch an Umsatzanteilen, die nicht allein auf die Erfindung, sondern auch auf den Qualitätsruf und das Vertriebs- und Servicenetz des Unternehmens zurückzuführen sind. Da dies hier der Fall ist, setze die Abstaffelung des Lizenzsatzes den Erfindungswert in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Erfindung für den Umsatz, entschied die Schiedsstelle. Der BGH (Entscheidung vom 4.10.1988 – Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid) habe zu Recht deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung von hohen Umsätzen eine Frage der Angemessenheit der Vergütung im Sinne von § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 keine verbindliche Vorschrift darstelle, sondern ein Hilfsmittel.
Umgekehrtes Verhältnis von Lizenzbelastung und verbleibenden Gewinnen
Beim Abschluss eines Second-Source-Lizenzvertrags müsse dem Lizenzgeber daran gelegen sein, entgangene Gewinne nach Möglichkeit durch Abschöpfung der beim ebenfalls lieferberechtigten Wettbewerber anfallenden Gewinne zu kompensieren, argumentierte die Schiedsstelle. Folglich werden in Second-Source-Lizenzverträgen vereinbarte Lizenzgebühren im Regelfall deutlich höher ausfallen, als dies in „normalen“ marktüblichen Lizenzverträgen der Fall wäre. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf gelte – wenn auch mit Vorbehalten – der Erfahrungssatz, dass die Höchstbelastung mit Lizenzsätzen üblicherweise bei 20 – 25 % der EBIT-Marge liegt (OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13). Folglich werde ein Second-Source-Lizenzvertrag eher das umgekehrte Verhältnis von Lizenzbelastung und verbleibenden Gewinnen aufweisen als ein marktüblicher Lizenzvertrag, also ein Verhältnis von 3:1 bis 4:1.
Second-Source-Lizenzvertrag muss korrigiert werden
Die Schiedsstelle schlug daher im vorliegenden Fall vor, von einem Faktor von 4:1 auszugehen, um damit auch der Frage der Abstaffelung gerecht zu werden. Die Schiedsstelle entscheidet, dass der über den ersten Erfindungskomplex vereinbarte Komplexlizenzsatz von 1 % des Umsatzes auf 0,25 % und der über den zweiten Erfindungskomplex vereinbarte Komplexlizenzsatz von 3 % des Umsatzes auf 0,75 % zu korrigieren ist, um zu marktüblichen Lizenzgebühren zu gelangen. Um von einem Second-Source-Lizenzvertrag auf einen marktüblichen Lizenzvertrag rückzuschließen, müssen Lizenzsätze aus Second-Source-Lizenzverträgen auf ein Verhältnis von 3:1 bis 4:1 korrigiert werden, formulierte die Schiedsstelle als nicht amtlichen Leitsatz.
Benötigen auch Sie Unterstützung im Arbeitnehmerfindungsrecht oder Patentrecht?
Nutzen Sie doch noch heute einen ersten und unverbindlichen Rückruf-Termin mit uns!
Quelle:
Schiedsstelle des DPMA – Arb.Erf. 30/16
Bild:
Free_Photos /pixabay.com / CCO License





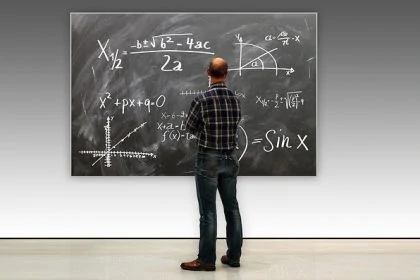


Schreiben Sie einen Kommentar