Die ersten großen Unternehmen haben bereits weitgreifende Entlassungen angekündigt. Damit verbunden sind auch Fragen zu Diensterfindungen: Entlassungen oder Insolvenzen, was ist zu beachten für Unternehmen und Erfinder?
 Grundsätzlich ist eine Diensterfindung dem Arbeitgeber zu melden, der wiederum die Pflicht hat, für diese Erfindung ein Schutzrecht anzumelden und sie dem Erfinder angemessen zu vergüten. Auch wenn die Erfindung nur betriebsintern genutzt wird oder sie zum Geschäftsgeheimnis erklärt wird, ist eine Vergütung zu zahlen.
Grundsätzlich ist eine Diensterfindung dem Arbeitgeber zu melden, der wiederum die Pflicht hat, für diese Erfindung ein Schutzrecht anzumelden und sie dem Erfinder angemessen zu vergüten. Auch wenn die Erfindung nur betriebsintern genutzt wird oder sie zum Geschäftsgeheimnis erklärt wird, ist eine Vergütung zu zahlen.
Lehnt der Arbeitgeber die Erfindung jedoch ab (er nutzt sie nicht oder er hält sie nicht für schutzfähig), muss er dies dem Erfinder mitteilen und die Erfindung freigeben.
So weit, so gut, könnte man sagen, all diese Sachverhalte sind im Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) geregelt. Kommt es aber zu Entlassungen oder sogar zu Insolvenzen, verbinden sich damit auch Fragen zu den Diensterfindungen: was ist zu beachten?
Fall 1: Insolvenz
Kommt es zur Insolvenz eines Unternehmens, wird häufig ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Wenn der Insolvenzverwalter nicht plant, die Diensterfindung zusammen mit dem insolventen Betrieb zu veräußern, ist er verpflichtet, die Diensterfindung sowie darauf bezogene Rechte und Pflichten dem Erfinder zur Übernahme anzubieten (§ 27 ArbEG) analog den Pflichten eines Arbeitgebers.
Wird aber jedoch Erwerber für den insolventen Geschäftsbetrieb gefunden, ist dieser Erwerber ab dem Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung vergütungspflichtig für eine Diensterfindung – wenn der Insolvenzverwalter die Diensterfindungen mit dem Geschäftsbetrieb veräußert (§ 27 Nr. 1 ArbEG).
Dies gilt auch dann, wenn nur ein Betriebsteil veräußert wird und in diesem Betriebsteil die Erfindung – zumindest theoretisch – genutzt wird. Zudem ist der Käufer eines insolventen Geschäftsbetriebs oder Betriebsteils auch dann vergütungspflichtig, auch wenn der Erfinder gar nicht mehr angestellt war zum Zeitpunkt der Insolvenz. Denn die Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung sind generell nicht von einem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses abhängig (§ 26 ArbEG).
Allerdings steht es dem neuen Vergütungsschuldner offen, sich durch Aufgabe des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung (nach § 16 ArbEG) der Vergütungspflicht zu entledigen. In einem solchen Fall also muss der neue Vergütungsschuldner sein Vorhaben dem Diensterfinder mitteilen und ihm auf dessen Wunsch alle Rechte auf die Erfindung übertragen.
Übertragung des Schutzrechts muss aktiv verlangt werden
Zu beachten ist, dass ein Diensterfinder die Übertragung der Erfindungsrechte aktiv fordern muss, und zwar innerhalb von 3 Monaten nach Mitteilung des neuen Vergütungsschuldners; denn nach dieser Frist ist der neue Arbeitgeber berechtigt, das Schutzrecht aufzugeben.
Fall 2: Entlassungen
Auch für Entlassungen gilt, dass die Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung generell nicht von einem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses abhängig sind (§ 26 ArbEG).
Häufig wird daher das Ausscheiden des Erfinders aus einem Unternehmen – sei es auf eigenen Wunsch oder im Rahmen von Entlassungen – mit einer pauschalen Zahlung für die Diensterfindung verbunden.
Das ist soweit auch in Ordnung und zulässig. Dennoch wirft gerade eine Pauschalvergütung Unsicherheiten auf.
Unsicher über die Pauschalvergütung
Was ist angemessen bei einer Pauschalvergütung? Und was kann ein Arbeitnehmer einwenden, wenn Druck auf ihn ausgeübt wird, einer Pauschalvergütung zuzustimmen?
Und was ist mit einer Anpassung der Vergütung, z. B. an Umsatzerfolge durch die Erfindung, vor allem wenn das Arbeitsverhältnis endet?
Vor der Schiedsstelle wurden solche Fragen bereits entschieden. Grundsätzlich gilt auch eine pauschale Vereinbarung als verbindlicher Vertrag. Eine Vertragsanpassung kann allerdings vorgenommen werden nach den §§ 133, 157 BGB – allerdings nur, wenn sich Umstände wesentlich ändern.
Als eine solche wesentliche Änderung gilt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn davon auszugehen ist, dass die Beteiligten von einem Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses ausgegangen waren bei der ursprünglichen Vergütungsvereinbarung. Es kann ein Anspruch auf Anpassung der Vergütungsregelung für die Zukunft bestehen, dies ist im Einzelfall zu entscheiden.
Auch wichtig zu wissen ist, dass eine Pauschalvergütung nicht „vorab“ vereinbart werden kann und ebenso wenig pauschal für alle Mitarbeiter gelten kann, sondern erst nach der ordnungsgemäßen Erfindungsmitteilung an den Arbeitgeber bzw. mit Bekanntwerden der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Vergütung angemessen?
Ob eine Vergütung oder Pauschalvergütung einer Diensterfindung „angemessen“ ist, ist nicht als konkrete Zahl zu beantworten, sondern wird mit der sogenannten Lizenzanalogie ermittelt, die u. a. die Stellung des Erfinders im Betrieb, die Wertzahl seiner Fachkenntnis und auch die Umsatzerwartungen in Bezug auf die Erfindung berücksichtigt.
Oftmals ist die Vergütung jedenfalls wesentlich geringer angesetzt als der Umsatzerfolg oder die Nutzung im Unternehmen vermuten ließen. Dazu muss man sagen: Vergütung steigt nicht linear mit dem Gewinn durch die Erfindung. Vielmehr ist die Gewinnerwartung maßgeblich für eine „angemessene“ Höhe der Vergütung. Ist ein Erfinder dennoch der Meinung, die Vergütung oder Pauschalvergütung sei nicht angemessen, kann er sich auf „Unbilligkeit“ berufen. Es gibt aber hohe Anforderungen für einen solchen Sachverhalt.
Die Schiedsstelle erkennt erst dann eine mögliche Unbilligkeit für eine Pauschalvergütung an, wenn der tatsächliche Nutzungsumfang etwa dreimal so hoch ist wie die prognostizierte Nutzung. Außerdem muss die Unbilligkeit der geschlossenen Vereinbarung von Anfang anhaften. Grundsätzlich kann Unbilligkeit geltend gemacht werden bis sechs Monate nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen.
Verjährung von Ansprüchen
Es gibt natürlich Fristen zur Verjährung von Ansprüchen. Die Ansprüche auf Vergütung verjähren nach 3 Jahren, Ansprüche auf Schadensersatz nach 10 Jahren. Es ist zu beachten, dass ein Schadensersatz nur geltend gemacht werden kann, wenn zuvor ein Vergütungsanspruch innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist gestellt wurde.
Wird zur Klärung von Arbeitnehmererfinderrechten die Schiedsstelle angerufen, gilt die Verjährung in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 (4) BGB als gehemmt. Es ist politisch gewollt, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder möglichst vor der Schiedsstelle einigen, die immer auch einen Schlichtungsauftrag hat.
Haben Sie Fragen zur Vergütung einer Diensterfindung?
Unsere Kanzlei für Patent- und Markenrecht verfügt über weitreichende Expertise im Bereich des Patentrechts und Erfinderrechts für Arbeitnehmer.
Gern vertreten wir Ihre Interessen sowohl vor der Schiedsstelle als auch in einem möglicherweise notwendig werdenden Gerichtsverfahren. Nehmen Sie bei Interesse gerne Kontakt auf – auch für eine erste Einschätzung der Sachlage stehen wir gerne zur Verfügung.

Quellen:
Arbeitnehmererfindergesetz und Entscheidungspraxis der Schiedsstelle
Bild:




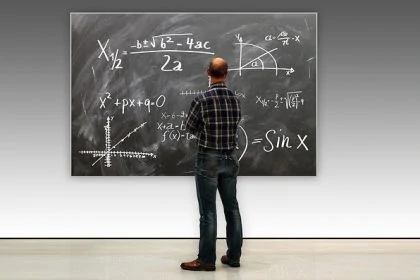


Schreiben Sie einen Kommentar