Gerne wird in einem Aufhebungsvertrag mit Diensterfindung formuliert, dass sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz abgegolten seien. Ist das erlaubt? Und was gilt bei einer Akontozahlung? Besteht dann sogar die Gefahr einer Rückzahlung?
 Die Rechtslage für einen Aufhebungsvertrag mit Diensterfindung ist nicht ganz einfach zu übersehen. Grundsätzlich ist schließlich eine pauschale Erfindervergütung zulässig, und auch Aufhebungsverträge mit pauschaler Abgeltung von Ansprüchen aus der Diensterfindung sind üblich. Typischerweise ist dies so formuliert, dass mit der getroffenen Abfindungsregelung eine Regelung über Abfindungszahlungen „als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes“ sowie sämtliche Ansprüche des Arbeitnehmers aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen abgegolten sein sollen.
Die Rechtslage für einen Aufhebungsvertrag mit Diensterfindung ist nicht ganz einfach zu übersehen. Grundsätzlich ist schließlich eine pauschale Erfindervergütung zulässig, und auch Aufhebungsverträge mit pauschaler Abgeltung von Ansprüchen aus der Diensterfindung sind üblich. Typischerweise ist dies so formuliert, dass mit der getroffenen Abfindungsregelung eine Regelung über Abfindungszahlungen „als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes“ sowie sämtliche Ansprüche des Arbeitnehmers aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen abgegolten sein sollen.
Arbeitsplatzaufhebung erstreckt sich nicht auf Erfindervergütung
Wird in so einem Aufhebungsvertrag allerdings kein Abfindungsbetrag für die Erfindervergütungsansprüche explizit genannt, ist die Abgeltung der Vergütungsansprüche durch die Zahlung im Aufhebungsvertrag nicht wirksam, hat die Schiedsstelle festgelegt – wir berichteten (Arb.Erf. 36 / 15). Denn der Anspruch auf eine Arbeitnehmererfindervergütung besteht nach § 26 ArbEG auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiter, nämlich solange das Schutzrecht und damit der Monopolvorteil besteht. Der Vergütungsanspruch – auch in einem Aufhebungsvertrag – ist daher unabhängig vom Erhalt oder Verlust des Arbeitsplatzes.
Aufhebungsvertrag mit Diensterfindung als Akontozahlung
Was aber gilt, wenn in einem Aufhebungsvertrag eine sogenannte Akontozahlung auf noch offene, in ihrer Höhe noch zu ermittelnden Vergütungsansprüche des Erfinders vereinbart werden? Rechtlich handelt es sich dabei um eine Teilzahlung eines Schuldners auf eine bestehende Geldschuld, der Begriff Akontozahlung ist ein Synonym für „Abschlagszahlung“.
Mit einer solchen Vereinbarung ist es theoretisch auch möglich, dass ein Erfinder sogar eine noch höhere Vergütung beanspruchen kann, als die Höhe der Akontosumme festlegt. Praktisch allerdings ist das sicherlich selten, denn Vergütungsansprüche, die über die vereinbarte Akontosumme hinausgehen, müssen den Vergütungsfaktoren gemäß fiktiver oder tatsächlicher Lizenzanalogie entsprechen.
Schauen wir also direkt in die Praxis. In einem konkreten Fall (Arb.Erf. 31/16), den die Schiedsstelle im letzten Jahr verhandelte, hatte Arbeitgeberin Intel in einem Aufhebungsvertrag eine Akontozahlung mit der Akontosumme 100.000 USD zur Abgeltung aller Vergütungsansprüche festgelegt.
War die Akontosumme angemessen?
Ein kurzes Rechenbeispiel zeigt, dass diese Akontosumme durchaus als großzügig anzusehen ist.
Softwareumsätze wurden in Höhe von 8.382.427 USD für den Gesamtnutzungszeitraum gemacht.
Mit einem als marktüblich anzusehenden Lizenzsatz von 5 % und einem Miterfinderanteil von 64 % ergibt sich ein tatsächlicher Erfindungswert von 268.238 USD.
Dieser wird noch mit dem Anteilsfaktor von 16,5 % verrechnet, das ergibt einen Vergütungsanspruch von 44.259 USD.
Keine Rückzahlung der Akontosumme
Arbeitgeberin Intel schätzte wohl den angemessenen Vergütungsanspruch als noch geringer ein. Nach Auszahlung der vereinbarten Akontosumme als Pauschale jedenfalls verlangte Intel die Rückzahlung eines Großteils der Auszahlung. Insbesondere berief sich die Arbeitgeberin darauf, dass man ja schließlich eine Akontozahlung auf die Gesamtabfindung vereinbart habe.
Doch diesem Vorgehen erteilte die Schiedsstelle eine Absage. Da „Akontozahlung“ die Bedeutung „Abschlagszahlung“ hat, könne Akontozahlung nur so verstanden werden, dass die noch offene Vergütungsschuld für die Diensterfindungen zumindest in Höhe der Akontosumme vereinbart ist. Eine Rückzahlung bei geringerer Vergütungsschuld sei damit grundsätzlich nicht vereinbart, legte die Schiedsstelle als nicht-amtlichen Leitsatz fest.
Software Erfindung in Hardware
Allerdings habe der Erfinder im vorliegenden Fall auch keine Vergütungsansprüche über den Aufhebungsvertrag hinaus, erläuterte die Schiedsstelle.
Durch Addition von Vergütungsansprüchen aus weiteren Erfindungen des Arbeitnehmers und gleichzeitiger Anwendung von einer Abstaffelung sah die Schiedsstelle schlussendlich 60.192 USD als sachgerecht ermittelten Vergütungsanspruch in diesem konkreten Fall- und ergänzte auch ausdrücklich, dass nicht nachgewiesen wurde, in welcher Hinsicht die streitgegenständlichen Diensterfindungen zu monopolgeschützten Hardwareprodukten geführt haben könnten. Denn nur ein so einem Fall entstehen Vergütungsansprüche aus der Hardware.
Die Schiedsstelle formulierte das so: „Benutzt die Softwareerfindung einen offenen Standard und erlaubt den Einsatz heterogener Hardwarearchitekturen, dann führen softwarebezogene Erfindungen regelmäßig nicht zu monopolgeschützten Hardwareprodukten“ – und so hat die Schiedsstelle auch in anderen Fällen entschieden.
Sind Sie als Arbeitgeber oder Arbeitnehmererfinder betroffen?
Wenn Sie im Zweifel sind, sprechen Sie uns gerne an. Unsere Patentanwaltskanzlei verfügt über eine weitreichende Expertise im Bereich des Patentrechts und Arbeitnehmererfinderrechts, und gerade in Erfindungskomplexen mit Softwareanpassung ist die Betrachtung als Einzelfall entscheidend.
Gern vertreten wir Ihre Interessen sowohl vor der Schiedsstelle als auch in einem möglicherweise notwendig werdenden Gerichtsverfahren. Wir laden Sie ein, unser Beratungsangebot zu nutzen.

Quellen:
Entscheidung der Schiedsstelle 31/16
Bild:




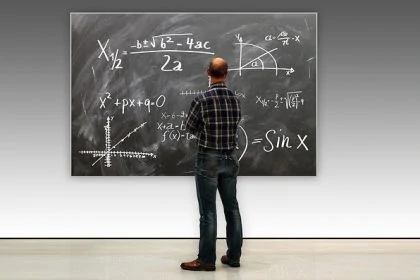


Schreiben Sie einen Kommentar