Ein Anschlussinhaber eines Internetanschlusses konnte bisher nicht der Urheberrechtsverletzung für Filesharing bezichtigt werden, sobald auch andere Familienmitglieder auf den Anschluss Zugriff hatten. Das Urteil des EuGH ändert diese Praxis.
Mit Spannung wurde am 18.10.2018 die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einem Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV erwartet, das das Landgericht München zur Vorlage gebracht hatte:
Rechtlicher Hintergrund zum Vorabentscheidungsverfahren
 Die Kölner Verlagsgruppe Bastei Lübbe ist Inhaberin von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten als Tonträgerherstellerin an der Hörbuchfassung eines Buches. Dem Beklagten, ein privater Inhaber eines Internetanschlusses, wurde am 08.05.2010 das besagte Hörbuch von Nutzern einer Internet-Tauschbörse „peer-to-peer“ als Download angeboten. Nach erfolgloser Abmahnung verklagte der Verlag den Anschlussnehmer vor dem Amtsgericht München auf Unterlassung und Schadensersatz nach § 97 UrhG. Der Beklagte berief sich darauf, dass nicht nur er, sondern grundsätzlich auch seine im selben Haus wohnenden Eltern auf seinen Internetanschluss Zugriff gehabt hätten. Da deshalb nicht einwandfrei zu klären gewesen sei, von wem das Hörbuch heruntergeladen worden war, wies das Gericht die Klage ab. Die Klägerin ging daraufhin in Berufung gegen das Urteil.
Die Kölner Verlagsgruppe Bastei Lübbe ist Inhaberin von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten als Tonträgerherstellerin an der Hörbuchfassung eines Buches. Dem Beklagten, ein privater Inhaber eines Internetanschlusses, wurde am 08.05.2010 das besagte Hörbuch von Nutzern einer Internet-Tauschbörse „peer-to-peer“ als Download angeboten. Nach erfolgloser Abmahnung verklagte der Verlag den Anschlussnehmer vor dem Amtsgericht München auf Unterlassung und Schadensersatz nach § 97 UrhG. Der Beklagte berief sich darauf, dass nicht nur er, sondern grundsätzlich auch seine im selben Haus wohnenden Eltern auf seinen Internetanschluss Zugriff gehabt hätten. Da deshalb nicht einwandfrei zu klären gewesen sei, von wem das Hörbuch heruntergeladen worden war, wies das Gericht die Klage ab. Die Klägerin ging daraufhin in Berufung gegen das Urteil.
Hintergrund für die Vorlage zum Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH war letztlich die Frage, ob der Klägerin der Beweis gelingen muss, dass nur allein der Anschlussinhaber die Urheberrechtsverletzung begangen haben kann. Dieser konnte sich der Haftung nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nämlich dadurch entziehen, dass auch andere Personen auf den Internetanschluss Zugriff gehabt haben. Solange er dies nachweisen konnte, musste er im Falle von Familienangehörigen zum Schutz des Familienlebens nach Art. 7 Grundrechte-Charta der Europäischen Union sowie Art. 6 GG nicht einmal genauere Angaben über Zeitpunkt und Nutzungsart des Internetanschlusses machen.
Da die maßgeblichen Vorschriften im deutschen Urheberrecht europäischen Richtlinien (Richtlinie 2001/29 und Richtlinie 2004/48) entstammen, sah sich das Landgericht daher dazu veranlasst, die Angelegenheit vom EuGH klären zu lassen.
Abwägung europäischer Grundrechte
Dieser entschied nun, dass unter Zugrundelegung der beiden Richtlinien und ihren Erwägungsgründen die bisherige Handhabung deutscher Gerichte einer rechtlichen Prüfung nicht standhalte: Zu beantworten sei nach Auslegung des EuGH die Frage, wie die europäischen Grundrechte auf einen wirksamen Rechtsbehelf sowie des geistigen Eigentums einerseits und das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens andererseits miteinander in Einklang gebracht werden können.
Dieser Schutz von Privat- und Familienleben könne jedenfalls nicht so weit gehen, dass er das mit der Sache befasste Gericht und damit auch den Inhaber der Urheberrechte selbst daran hindert, die nötigen Beweismittel zu verlangen, um den Täter zu identifizieren, der die Urheberrechtsverletzung tatsächlich begangen hat. Die Grundrechte der Klägerin seien dadurch qualifiziert beeinträchtigt; die nationale Regelung genüge einem angemessenen Gleichgewicht der besagten Grundrechte deshalb nicht, so der EuGH.
Urteil folgt der bisherigen Rechtsprechung
Mit der Entscheidung setzt EuGH seine Linie fort, Inhabern von Ausschließlichkeitsrechten wie Marken- oder Urheberrechten umfassende Möglichkeiten einzuräumen, eine behauptete Rechtsverletzung auch vor Gericht zu beweisen. Schon im Juli 2015 hatte er in der Sache Coty Germany gegen Stadtsparkasse Magdeburg entschieden, dass auch eine nationale Rechtsvorschrift, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und bedingungslos gestatte, eine Auskunft über Namen und Anschrift des Kontoinhabers unter Berufung unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern. Auch dies stellte damals eine qualifizierte Beeinträchtigung des Rechts auf wirksamen Rechtsbehelf und des Rechts des geistigen Eigentums dar.
Insofern ergibt sich aus der aktuellen Entscheidung wenig überraschend Neues, auch wenn sie beim Filesharing zu einer fraglos höchst brisanten Materie ergangen ist. Das Ausweichmanöver eines wegen Urheberrechtsverletzung Beklagten, sich auf etwaige andere Familienmitglieder zu berufen, die über den Internetanschluss die rechtsverletzenden Inhalte genauso hätten heruntergeladen haben können, gelingt damit zukünftig nicht mehr – ohne weitere Angaben zu machen, die durch geeignete Untersuchungen ermittelt wurden, wann und wie das Internet von diesem Familienmitglied genutzt wurde. Wie die Reaktion auf nationaler Ebene ausfällt, bleibt dagegen nun erst einmal abzuwarten. Fest steht jedenfalls, dass das Landgericht München die Entscheidung des EuGH in seinem Urteil zu berücksichtigen hat.
Sie benötigen Hilfe im Urheberrecht oder Copyright?
Wenden Sie sich an unsere Anwälte, die Experten im Schutz von geistigem Eigentum sind. Nehmen Sie noch heute Kontakt auf und lassen sich beraten – wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Quelle:
Curia Europe: C:2018:841 Bastei Lübbe
Curia Europe: C:2015:485 Coty Germany
Bild:


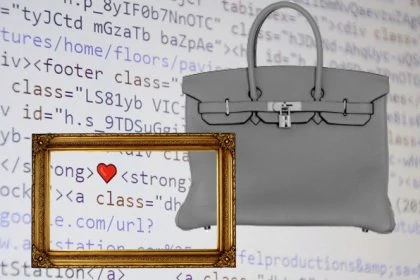





Schreiben Sie einen Kommentar