Viele Anmeldungen einer Unionsmarke oder auch einer nationalen Marke scheitern an der fehlenden oder nicht ausreichenden Unterscheidungskraft. Ist dabei auf die wahrscheinlichste Verwendungsform abzustellen? Der BGH entschied kürzlich über den Fall #darferdas und legt diese Frage dem EuGH vor.
Fehlende Unterscheidungskraft zählt zu den absoluten Eintragungshindernissen. Dies zu überwinden ist nur möglich durch den sogenannten Nachweis der Verkehrsgeltung, im europäischen Recht wird dies Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft genannt. Im vorliegenden Fall ( I ZB 61/17 ) machten die Anmelder geltend, dass sie das angemeldete Zeichen auf eine weniger wahrscheinliche Art benutzen wollten.
Dem BGH sieht daher die Frage von dem EuGH zu klären: Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?
Der Sachverhalt
 Das deutsche Patent- und Markenamt wies die Anmeldung der Wortmarke #darferdas? für Waren der Nizza-Klasse 25 (Bekleidungsstücke wie T-Shirts und Kopfbedeckungen) wegen fehlender Unterscheidungskraft zurück. Die Beschwerde der Anmelderin blieb ohne Erfolg (BPatG, Beschluss vom 3. Mai 2017 – 27 W(pat) 551/16), dennoch verfolgte sie ihr Eintragungsbegehren weiter.
Das deutsche Patent- und Markenamt wies die Anmeldung der Wortmarke #darferdas? für Waren der Nizza-Klasse 25 (Bekleidungsstücke wie T-Shirts und Kopfbedeckungen) wegen fehlender Unterscheidungskraft zurück. Die Beschwerde der Anmelderin blieb ohne Erfolg (BPatG, Beschluss vom 3. Mai 2017 – 27 W(pat) 551/16), dennoch verfolgte sie ihr Eintragungsbegehren weiter.
Das Bundespatentgericht hatte angenommen, der angemeldeten Wortmarke fehle für die genannten Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die nicht regelgerechte Zusammenschreibung der Wörter und Kleinschreibung des ersten Buchstabes sei ein in der Werbung nicht unübliches stilistisches Mittel, begründete das BPatG, und zudem sei die Formulierung als Hashtag weit verbreitet. Bei dem reinen Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens handele es sich um eine in deutscher Sprache gehaltene unmittelbar verständliche Frage, die mit dem Fragezeichen entsprechend kenntlich gemacht sei. Es handele sich daher eine aus geläufigen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge, die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.
Dem stehe nicht entgegen, dass Hashtags ursprünglich aus dem Bereich der sozialen Medien stammten, betonte das BPatG. Denn sie würden auch im analogen Bereich und insbesondere in dekorativer Form auf Bekleidungsstücken verwendet und seien so bereits im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens verwendet worden.
Herkunftshinweis in Bekleidung
Der Bundesgerichtshof betrachtete zunächst die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft sei demnach die einer Marke innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke bestehe darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.
Ob Verbraucher ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffassen, könne nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. In Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, sei regelmäßig ein Herkunftshinweis zu sehen, während der Verbraucher in Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern, die auf der Vorderseite oder der Rückseite von Bekleidungsstücken angebracht sind, nicht generell einen Herkunftshinweis sehen, urteilte der BGH.
Ist auf die wahrscheinlichste Verwendungsform von #darferdas abzustellen?
 Entscheidend in dem Fall aber ist, dass das BPatG angenommen hatte, im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft sei auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens #darferdas abzustellen. Auf ebenfalls denkbare, aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame anderweitige Verwendungen komme es nicht an.
Entscheidend in dem Fall aber ist, dass das BPatG angenommen hatte, im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft sei auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens #darferdas abzustellen. Auf ebenfalls denkbare, aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame anderweitige Verwendungen komme es nicht an.
Der BGH sieht dies nicht eindeutig geklärt. Denn nach der Rechtsprechung des BGH muss im Eintragungsverfahren für die Annahme der Unterscheidungskraft nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein. Es genüge, wenn es dafür praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt.
Und für das Rechtsbeschwerdeverfahren sei zugunsten der Anmelderin davon auszugehen, dass es neben einer dekorativen Verwendung auch andere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten einer Verwendung des Zeichens für die hier in Rede stehenden Waren, beispielsweise auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, gebe.
Der BGH erachtet daher als entscheidungserheblich, ob auf die wahrscheinlichste Verwendungsform eines Zeichens abzustellen ist, und legt diese Frage daher dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung vor. Die Urteilsverkündung kann mit Spannung erwartet werden.
Möchten auch Sie Ihre Markenrechte sichern?
Jeder Fall wird von uns individuell und sorgfältig betrachtet. Nutzen Sie doch noch heute einen unverbindlichen Rückruf-Termin mit uns!

Quellen:
Bild:


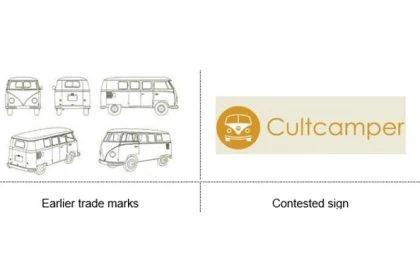


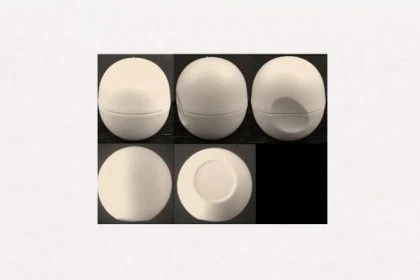

Schreiben Sie einen Kommentar